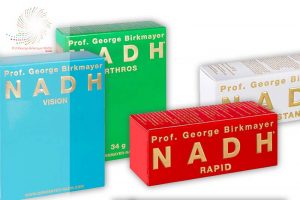Es klingt nach purer Ironie, ist aber traurige Wirklichkeit: Ausgerechnet die Arbeiter, die auf Feldern und Plantagen für die Produktion von Lebensmitteln ackern müssen, leiden selbst Hunger, weil ihre Löhne zu niedrig sind. Sie verdienen nicht nur zu wenig, sondern zahlen für ihre Arbeit auch noch einen hohen Preis: Sanitäranlagen und sauberes Wasser gibt es oftmals nicht. Dafür sind sie ständig gesundheitsgefährdenden Chemikalien aussetzt. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Die Zeit ist reif“ der Organisation Oxfam.
Vor allem weibliche Arbeiter betroffen
Unter den menschenunwürdigen Bedingungen leiden vor allem weibliche Arbeiter: „Die meisten Plantagenarbeiterinnen haben während ihrer Schicht von morgens um sieben bis zum Feierabend um fünf keinen Zugang zu Toiletten oder zu sauberem Wasser“, erläutert Colette Solomon von der Organisation „Women on Farms“. Diese führte jüngst Befragungen mit Hunderten von Arbeiterinnen zu ihrem Arbeitsalltag auf südafrikanischen Weinplantagen durch.
Zu den schwierigen Alltagsbedingungen auf den Plantagen, kommen gesundheitliche Risikofaktoren obendrauf: „Drei von vier Arbeiterinnen sind regelmäßig Chemikalien ausgesetzt. Sie bekommen keine Schutzkleidung, wenn sie eine stunde nach dem Spritzen auf die Plantage gehen, die Trauben sind dann noch feucht von den Pestiziden“, führt Solomon weiter aus. Auch macht der feine Sprühnebel am Ende der Felder nicht halt, sondern zieht weiter bis in die Siedlungen, in denen die Arbeiter leben. Der Preisdruck, der von den Supermärkten auf die Produzenten ausgeübt wird, trifft vor allem die Arbeiterinnen. Männliche Arbeiter sind in der Regel das ganze Jahr über beschäftigt oder sogar fest angestellt. Frauen werden immer häufiger nur in der Erntesaison oder nach Bedarf beschäftigt. Die Plantagenbesitzer haben keine Wahl, wenn sie ihren Ware gewinnbringend vermarkten wollen, denn der Handel möchte seine Produkte so günstig wie möglich an den Kunden bringen.
Ein globales Problem
Vor allem die vier großen deutschen Handelsketten Aldi, Lidl, Edeka und Rewe standen in dem durch Oxfam durchgeführten „Supermarkt-Check“ harsch in der Kritik. „Keine dieser Ketten wird ihrer Verantwortung gerecht, das Risiko von Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten zu identifizieren, öffentlich zu machen und entsprechend darauf zu reagieren.“, fasst der Bericht zusammen. Franziska Humbert, Oxfam-Expertin für soziale Unternehmensverantwortung, gibt deutlich zu verstehen: „Die Einkaufspolitik ist Teil der Sorgfaltspflicht der Supermärkte. Sie müssen mit ihren Lieferanten sprechen und die Einhaltung der Menschenrechte einfordern.“ In anderen Ländern, wie den USA oder Großbritannien, sei man da schon viel weiter. Während Edeka die Kritik von sich weist, zeigen sich immerhin Aldi, Lidl und Rewe offen dafür und geloben Besserung. Nicht nur die Supermärkte sieht Oxfam in der Pflicht, auch von Seiten der Politik gibt es in Deutschland einiges an Nachholbedarf.
Es gibt zwar den „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) der Bundesregierung, der enthält aber mehr Richtlinien als verbindliche Vorschriften. So etwas wie eine gesetzliche Prüfpflicht, wie sie in Frankreich existiert, gibt es nicht und ist auch nicht geplant. So können die Unternehmen weiter ihre Gewinne steigern, während die geringen Löhne der Arbeiter Existenzen bedrohen. Dabei gibt es theoretisch auch in Südafrika Gesetze, die Arbeiter schützen. Praktisch wissen die wenigsten davon. Organisationen wie Women on Farms versuchen da nachzubessern. Das alleine reicht aber nicht aus. Politiker vor Ort und in den Verbraucherländern, die Supermarktketten der Welt und auch der Endkunde können dazu beitragen, die Situation der Arbeiter zu verbessern. Solomon resümiert: „In einer globalisierten Welt mit globalisierten Lieferketten sind auch Moral und Verantwortung globalisiert.“